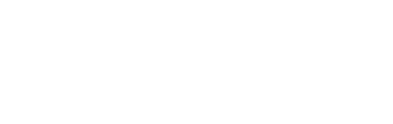Station 3: Magerrasen und Niederwald
Wir sind nun einen Kilometer weiter zu einer Wiese gelaufen. Am Rand: niedrige Buchenwälder, die man auch Niederwald nennt. Der nördliche Teutoburger Wald zwischen Lengerich und Lienen zeichnet sich durch besondere Naturgegebenheiten aus. Er ist Teil des Natur- und Geoparks TERRA.vita und zudem als Fauna-Flora-Habitat (FFH-Gebiet) gekennzeichnet. Um den Steinbruch herum gibt es schützenswerte Gebiete wie die des Magerrasens, Niederwälder und auch der Kalktuffquellen, welche die Gewässer des Umlands mit Wasser versorgen.
Magerrasen:
Beim Magerrasen handelt es sich um extensiv genutztes Grünland, welches auf nährstoffarmen Böden, wie hier auf Kalksteinböden gedeiht. Magerrasen wird im Gegensatz zu nährstoffreichen Grünflächen extensiv durch Schafe und Ziegen beweidet. Kalkreiche Böden oder Sandböden sind meist flachgründig bzw. leiten Niederschlagswasser schnell ab. Die daraus resultierende Nährstoffarmut und Trockenheit verhindern intensive Landwirtschaft.
Magerrasen ist durch anthropogene Einflüsse entstanden. Ursprünglich bestand der Teutoburger Wald aus zusammenhängenden Waldflächen. Durch Weidetiere, wie Schafe zum Beispiel, die junge Bäume und Sträucher verbissen und somit Lichtungen in den Wäldern hervorbrachten, verschwanden die Holzgewächse allmählich, sodass der Magerrasen zurückblieb.
Hier noch einige Fakten zu der besonderen Form des Magerrasens in Lengerich: Kalktrockenrasen :
-
Gedeiht auf ehemaligen Steinbruchflächen sehr gut, da durch den Abtrag der Humusschichten ein nährstoffarmer Boden zurückbleibt, welcher Niederschläge nur geringfügig oder nicht speichern kann
-
Oftmals in südlich exponierten Lagen
-
Viele seltene Tier- und Pflanzenarten gedeihen auf dem Magerrasen, auch viele Arten der „Roten Liste“
-
Charakteristisch sind kurze Gräser und eine große Vielfalt an schwachwüchsigen Blumen, wie die Küchenschelle, Silberdistel, Orchideen und kleine Enzianarten
-
Ähnlich der Heideflächen in der Lüneburger Heide
-
Pflegt man ihn nicht, kommt es zur Verbuschung der vorhandenen Gehölze
-
Weiterentwicklung zu trockenresistenten Waldgesellschaften wie die des Buchenwaldes
Gefährdet sind Magerrasen jedoch durch folgende Faktoren:
-
Mangelnde Rentabilität der Wanderschäferei
-
Aufdüngung zu Fettwiesen oder Umbruch zu Äckern an allen nicht zu steilen Stellen
-
Aufforstung mit Nadelhölzern
-
Überbauung (Straßen, Siedlungen, Industrie, Schrebergärten)
-
Nährstoffeintrag aus der Luft aufgrund landwirtschaftlicher und industrieller Emissionen sowie dem Verkehr
Aufgaben
10. Beschreibe die Standortbedingungen des Magerrasens!
11. Erkläre die Notwendigkeit der Schafbeweidung!

Abb. 43: Schafbeweidung. Quelle: Tina Iwanowski.
Abb. 44-48: Wiesenflächen am Dyckerhoff-Wanderweg. Quelle: T. Iwanowski.
Eine weitere Naturschutzmaßnahme ist die Erhaltung des Niederwaldes:
Buchenwälder wurden schon seit der Eisenzeit 1200 v. Chr. wiederholt gefällt, sodass ein widerstandsfähiger und regenerationsfähiger Wald entstand. Durch die lichte Fläche entwickelte sich eine dichte Krautschicht am Fuße der Buchen. Das stetige Abholzen nennt man auch „auf den Stock setzen“, da lediglich nur ein Baumstumpf zurückbleibt, der dann wieder neu austreibt. Das Holz wurde bis zum 19. Jahrhundert als Brennholz benutzt, welches die Hauptenergiequelle im Teutoburger Wald darstellte. Die Buchen wachsen schnell nach und bieten exzellentes Hartholz auch für die Herstellung von Möbeln.
 |  |  |
|---|---|---|
 |  |










Eine hohe Artenvielfalt!
Abb. 49-53: Fauna und Flora des FFH-Gebietes bei Lengerich. Quelle: T. Iwanowski.
Und was ist mit den kahlen Steinbrucharealen?
Steinbrüche bilden für viele Lebewesen, die in unserer intensiv genutzten Landschaft nicht mehr existieren können, wichtige Rückzugsgebiete, zum Beispiel für Orchideen, den Enzian und andere Pflanzenarten der Trockenrasengesellschaften, für Molche, Kröten und Schlangen, für viele seltene Schmetterlinge, deren Futterpflanzen nur hier noch gedeihen können, z. B. Bläulinge, Widderchen, Würfelfleckfalter, für Heuschrecken, Libellen und Käferarten, für Habicht, Sperber, Turmfalke, Uhu und Fledermäuse.
Und auch die Kalkwände stellen einen Lebensraum für ansonsten hier nicht vorkommende Tiere dar: z.B. Kreuzottern und Mauer- oder Zauneidechsen. Weil Gräser, Löwenzahn oder Brennnesseln hier nicht wuchern, können sich seltenere Pflanzenarten verschiedenster Kräuter und Gräser oft blütenreich hier entwickeln.
Da Steinbrüche oft nur als Löcher angesehen werden, die man mit Müll, Schutt oder Bodenaushub verfüllen kann, um sie dann im besten aufzuforsten, ist es notwendig, daß festgestellt wird, welche Steinbrüche erhalten werden müssen und welche verfüllt werden können.
Ein Beispiel für eine besonders seltene Pflanzenart: Orchideen
Ein Großteil der Orchideen unseres Gebietes ist sehr licht- und wärmebedürftig, bevorzugt daher offene Triften, lichte Gebüsche und Sekundärbiotope des Menschen (meist auf Kalk). Waldorchideen wachsen derweil im Kalk-Buchenwald. Wenige Arten bevorzugen extensive Feuchtwiesen und anmoorige Stellen.
Die Bedrohungen und Gefährdungen unserer letzten Orchideen-Lebensräume sind vielfältig. Ihr
Rückgang wird verursacht durch:
-
jedwede Düngung des Standortes.
-
Entwässerung und Intensivierung alter Feuchtwiesen und Heiden.
-
Umwandlung des bodenständigen Kalk-Buchenwaldes in Fichten- und Pappelkulturen.
-
Verbuschung und Verschattung an Standorten lichtliebender Arten.


Abb. 54: Ehemaliges Steinbruchareal - nun bepflanzt. Quelle: T. Iwanowski.

Abb. 55: Hundswurz auf dem Trockenrasen der aufgelassenen Kalksteinbrüche (innerhalb Westfalens nur noch in Lengerich vorhanden). Quelle: Petra Wörle: http://nwv-schwaben.de/galerie/gallmin/files/Naturfotografie/Artenpool/Pflanzen/Samenpflanzen/Bedecktsamer/Einkeimlblaettrige/Liliiflorae/Orchideenartige/Orchideengewaechse/Hundswurz/PyramidenHundswurz/.
Damit die ursprüngliche Natur innerhalb und außerhalb der Abbaugebiete erhalten bleibt, setzen sich Dyckerhoff und die Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Tecklenburger Land e.V. für zahlreiche Naturschutzmaßnahmen und auch die Renaturierung diverser ehemaliger Steinbruchgebiete ein:
Ende der 80er Jahre begannen die Renaturierungsmaßnahmen. Bäume wurden gepflanzt, Böden aufgetragen und Kleingewässer angelegt. Unter anderen leben nun Amphibien in den Feuchtbiotopen, z. B. auch der vom Aussterben bedrohte Laubfrosch. Und auch die Wanderschäfereien werden von Dyckerhoff organisiert.
Auf der Seite der Firma Dyckerhoff in Lengerich könnt ihr euch die Renaturierungsmaßnahmen nach der Beendigung des Kalksteinabbaus anschauen.
Aufgaben
12. Begründe, warum der Magerrasen bedroht ist!
13. Erkläre, warum die Firma Dyckerhoff finanziell aufwendige Naturschutzmaßnahmen durchführt!